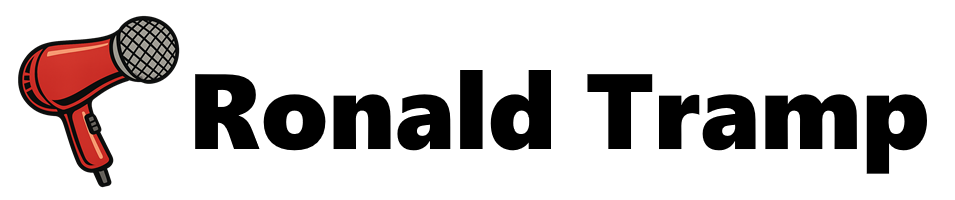Der Abfahrtslauf der Empörung

Wie man einen Wintersportler politisch stürzt, ohne Schnee zu berühren
Von Ronald Tramp, Sonderkorrespondent für nationale Gefühle, gekränkte Egos und olympisches Drama in Thermo-Unterwäsche
Es gibt Tage, da wird Geschichte geschrieben. Große Tage. Riesige Tage. Und dann gibt es diese ganz besonderen Tage, an denen jemand auf Skiern steht, etwas Nachdenkliches sagt – und damit eine Lawine lostritt, die nicht aus Schnee besteht, sondern aus Großbuchstaben, Ausrufezeichen und verletztem Stolz. Willkommen im patriotischen Parallel-Slalom.
Ein junger Athlet, geschniegelt, durchtrainiert, mit der Fähigkeit, sich rückwärts einen Abhang hinunterzuschrauben, wagt es, öffentlich „gemischte Gefühle“ zu haben. Gemischte Gefühle! In einem Land, das Gefühle normalerweise nur in zwei Geschmacksrichtungen kennt: fantastisch oder verräterisch. Er sagt nicht: Alles ist schlimm. Er sagt nicht: Ich verweigere mich. Nein. Er sagt lediglich: Es gibt Dinge, die mir nicht gefallen. Ein Satz so harmlos, dass er in anderen Ländern als Einstieg in ein höfliches Gespräch gilt. Hier jedoch ist er der Startschuss für den nationalen Empörungs-Biathlon.
Der Athlet erklärt sogar brav, warum er trotzdem antritt. Nicht für Ideologien, nicht für Parolen, sondern für Familie, Freunde, Menschen zu Hause, für persönliche Werte. Kurz gesagt: für alles, was man eigentlich hören möchte, wenn jemand mit Landesflagge auf der Jacke einen Berg herunterrast. Doch genau hier liegt das Problem. Persönliche Werte. Nicht zentral genehmigt. Nicht vorab abgestempelt. Gefährlich.
Denn kaum sind diese Worte ausgesprochen, erscheint aus den digitalen Nebeln der sozialen Medien die große Stimme des beleidigten Patriotismus. Donnernd. Majestätisch. Tippend mit der Wucht eines Presslufthammers. Das Urteil ist schnell gefällt, denn lange Nachdenken ist bekanntermaßen etwas für schwache Knie: „Loser.“ Ein Wort. Zwei Silben. Drei Ausrufezeichen im Herzen.
Der Athlet wird nicht kritisiert, nicht hinterfragt, nicht eingeordnet. Nein. Er wird etikettiert. Abgeheftet. Wegsortiert. Ein Loser. Und zwar ein echter. Was auch immer das bedeutet. Wahrscheinlich jemand, der es gewagt hat, gleichzeitig stolz und kritisch zu sein. Also praktisch ein politischer Snowboarder: zu quer für die Abfahrt, zu schnell für die Kontrolle.
Besonders faszinierend ist die Logik dahinter. Ein Mann, der bei Olympischen Spielen antritt, also buchstäblich zur Weltspitze gehört, wird als Verlierer bezeichnet – von jemandem, der Sport bevorzugt vom Sofa aus verfolgt, vorzugsweise mit Burger in der Hand und Empörung im Anschlag. Aber das ist keine Ironie. Das ist Tradition. In diesem Weltbild gewinnt nicht, wer Leistung bringt, sondern wer am lautesten klatscht – für die richtigen Dinge.
„Es ist schwer, für so jemanden zu jubeln“, heißt es dann. Schwer! Als wäre Jubeln eine olympische Disziplin mit Mindestanforderungen an Gedankenreinheit. Als müsste man vor dem Applaus erst ein Loyalitätsformular ausfüllen. Dabei jubelt man bei Sportveranstaltungen traditionell für Menschen, die schnell, hoch oder elegant sind – nicht für ihre Fähigkeit, politische Slogans auswendig zu lernen.
Was hier passiert, ist größer als ein Streit. Es ist ein kultureller Hochsprung mit der Latte auf Stirnhöhe. Der Athlet sagt: Ich bin Teil dieses Landes, aber ich sehe auch Probleme. Die Antwort lautet: Dann spring doch woanders. Kritik wird nicht als Engagement verstanden, sondern als Verrat im Schneetarnanzug.
Das olympische Umfeld, sonst so bedacht auf Neutralität, Fairness und das freundliche Winken mit Fähnchen, steht plötzlich mitten in einem Shitstorm, der mehr Hitze erzeugt als jede Fackel im Eröffnungsstadion. Athleten sollen schweigen, außer sie sagen genau das Richtige. Und das Richtige ist bekanntlich immer das, was gerade in Großbuchstaben getippt wird.
Ob der Freestyle-Fahrer reagiert? Vielleicht. Vielleicht auch nicht. Vielleicht fährt er einfach weiter. Und das wäre die größte Provokation von allen: Leistung zeigen, ohne zurückzuschreien. In einer Welt, in der Beleidigung als Führungsstil gilt, ist Würde der radikalste Akt.
Und so bleibt am Ende ein Bild: Ein Mensch auf Skiern, der sagt, was er fühlt. Und ein anderer, der sagt, was er tippt. Der eine gleitet elegant über Schnee. Der andere rutscht wütend durch die Kommentarspalten der Geschichte. Wer hier wirklich fällt, entscheidet nicht die Zeitmessung – sondern das Gedächtnis.