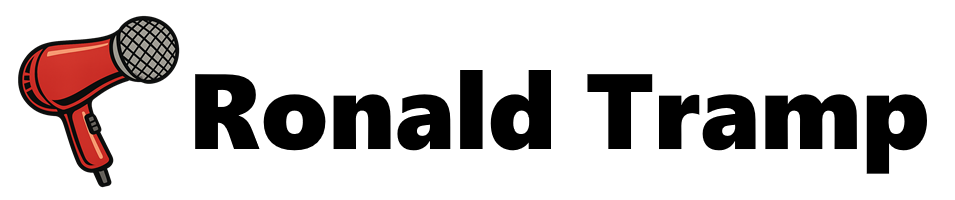Der große Kostenbescheid-Komplex

Wie ein Auto abgeschleppt und die Logik gleich mitgenommen wurde
Von Ronald Tramp, Sonderberichterstatter für stehende Fahrzeuge, rollende Gebühren und die Kunst, Rechnungen größer zu machen als nötig
Es beginnt wie immer harmlos. Ein Auto. Ein Parkplatz. Ein paar Minuten. Vielleicht auch ein paar mehr. Dann das große Nichts. Das Auto ist weg. Verschwunden. Entführt. Nicht von Aliens, sondern von der kommunalen Ordnungsmacht mit Haken, Seil und sehr gutem Selbstbewusstsein.
Was folgt, ist ein Ritual, das viele kennen und niemand liebt: der Kostenbescheid. Ein Dokument von majestätischer Länge, mit Zahlen, die nicht erklären, sondern fordern. Abschleppkosten? Klar. Verwaltung? Verständlich. Aber dann taucht er auf, der heimliche Star der Rechnung: die Gebühr für die Erstellung der Rechnung selbst. Ein Gebühren-Matroschka-Prinzip. Du zahlst, weil du zahlen sollst – und extra dafür, dass man dir sagt, dass du zahlen sollst.
Doch diesmal hat jemand gesagt: Moment mal. Ein Mensch. Ein Autohalter. Ein moderner Held im Schatten der Parkverbotsschilder. Er hat nicht einfach gezahlt. Er hat gefragt. Und dann geklagt. Und plötzlich stand nicht mehr das Auto im Fokus, sondern die Frage: Darf eine Stadt Geld dafür verlangen, dass sie dir Geld abverlangt?
Die Antwort aus der richterlichen Tiefe: Nein. Nein, darf sie nicht. Nicht zusätzlich. Nicht kreativ. Nicht mit Extra-Zeile. Die Kosten fürs Abschleppen? Ja. Die Grundgebühr? Auch ja. Aber die Gebühr für das Tippen der Rechnung? Das ist zu viel der Liebe.
Das zuständige Gericht stellte klar: Verwaltung ist Verwaltung. Und Verwaltung kostet. Aber Verwaltung darf nicht anfangen, sich selbst zu monetarisieren wie ein Abo-Modell mit Zusatzfunktionen. Kostenbescheid Pro – jetzt mit Mahngebühren!
Die Stadt hatte zuvor eine stolze Summe gefordert. Nicht nur Abschleppkosten, sondern auch Mahngebühren und Zusatzposten, die sich anfühlten wie DLCs in einem Videospiel. Basisversion: 30 Euro. Premium-Paket: 139 Euro plus Abschleppwagen. Deluxe-Edition: Ärger inklusive.
Doch das Gericht zog die Handbremse. Sanft, aber bestimmt. Es sagte sinngemäß: So nicht. Der Bürger zahlt, was anfällt – aber nicht für die Existenz eines PDFs.
Natürlich ist das Urteil noch nicht das Ende der Straße. Es ist nicht rechtskräftig. Es gibt noch die höhere Instanz. Und wir wissen: Wenn es irgendwo noch eine Instanz gibt, dann wird sie zumindest erwogen. Vielleicht beantragt. Vielleicht auch nicht. Denn auch Berufungen kosten. Und man möchte ja nicht versehentlich eine Gebühr für die Beantragung der Berufung zur Gebühr einführen.
Ich, Ronald Tramp, sage: Das ist kein Streit um Parken. Das ist ein Grundsatzurteil zur Gebührenökonomie. Zur Frage, wie viel Staat im Staat steckt – und wie viele Zeilen eine Rechnung haben darf, bevor sie philosophisch wird.
Denn wo fängt es an, wo hört es auf? Heute ist es der Kostenbescheid. Morgen die Gebühr für das Öffnen des Umschlags. Übermorgen der Zuschlag für die gedankliche Verarbeitung der Forderung. Sie haben länger als 30 Sekunden über die Rechnung nachgedacht – bitte überweisen Sie weitere 12 Euro.
Der Fall zeigt vor allem eines: Der Bürger ist nicht nur Zahler. Er ist auch Leser. Und manchmal sogar Denker. Und wenn er merkt, dass etwas nicht stimmt, kann es passieren, dass die Verwaltung plötzlich erklären muss, warum sie etwas erklärt – gegen Geld.
Das Gericht hat damit ein kleines, aber feines Stoppschild aufgestellt. Kein großes Drama. Kein Umsturz. Aber ein klarer Hinweis: Nicht alles, was berechnet werden kann, darf auch berechnet werden.
Für Autofahrer ist das ein Hoffnungsschimmer. Für Verwaltungen ein sanfter Reminder. Und für Parkschilder ein stilles Lächeln. Denn sie wissen: Am Ende stehen sie immer noch da. Und jemand wird wieder falsch parken.
Und wenn es soweit ist, dann wird abgeschleppt. Bezahlt. Und hoffentlich korrekt abgerechnet. Ohne Gebühren für die Gebühr. Ohne Mahngebühren für die Mahngebühr. Ohne Rechnung über die Rechnung.
Bis dahin empfehle ich: Parken Sie richtig. Oder lesen Sie Urteile. Beides kann Geld sparen.