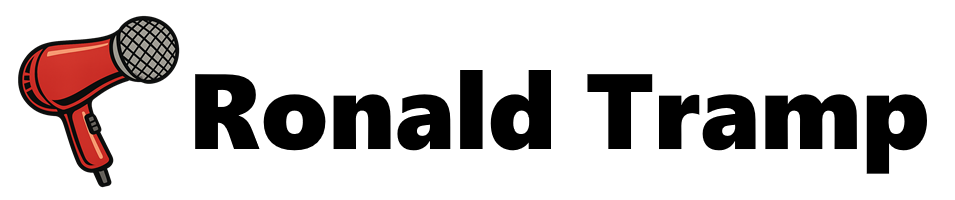Der Kopf hat sich’s anders überlegt – Die spektakulärste Rückgabe seit dem Ablasshandel
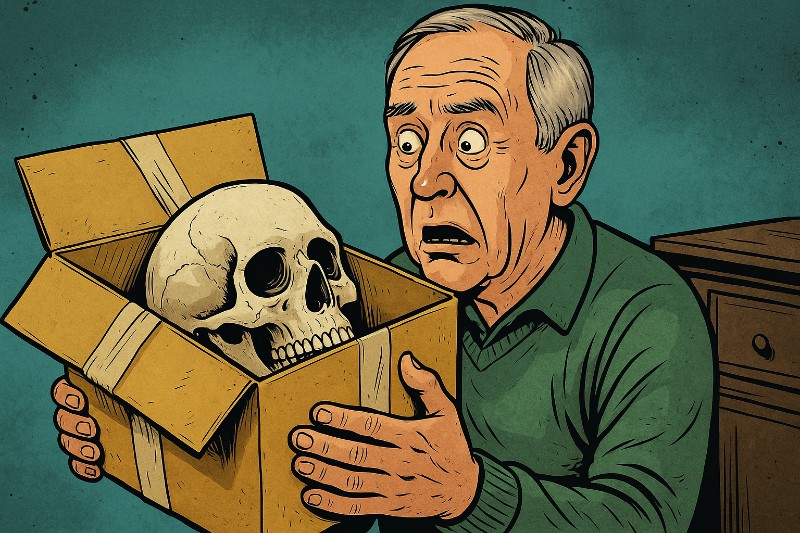
Freunde, Patrioten, Totenkopfsammler – haltet euch fest!
Ich, Ronald Tramp, investigativer Reporter mit der Lizenz zum Läuten, präsentiere euch heute eine Geschichte, die so schaurig schön ist, dass selbst Indiana Jones sagen würde: „Respekt, Alter, das nenn ich späte Reue.“
In Wien, der Stadt der Oper, des Schnitzels und der morbiden Romantik, hat sich etwas Unfassbares ereignet.
Ein Mann – nennen wir ihn den Reuigen Räuber von Rügen – hat nach 60 Jahren einen menschlichen Schädel an den Stephansdom zurückgeschickt.
Ja, richtig gehört. Kein Buch, keine Mahnung, kein VHS-Kurs.
Ein Schädel.
Und das Ganze per Post.
Ganz anonym. Ganz diskret.
Ein Paket ohne Absender, das vermutlich schwerer auf dem Gewissen lag als in der Hand des Postboten.
„Auf meinem Schreibtisch lag plötzlich ein großes, verschnürtes Paket“
So beschreibt es Franz Zehetner, der Domarchitekt des Wiener Stephansdoms.
Klingt wie der Anfang eines Horrorfilms, ist aber Realität.
Er öffnet das Paket – und da liegt er: Ein Schädel.
Nicht aus Plastik, nicht aus Halloween-Deko, sondern original menschlich, vermutlich Jahrgang „barock bis leicht gotisch“.
Dazu ein Brief – handgeschrieben, natürlich. Kein E-Mail, kein WhatsApp mit Totenkopf-Emoji.
Ganz klassisch.
Der Verfasser, laut eigener Aussage ein älterer Mann aus Norddeutschland, schreibt:
„Ich habe den Kopf einst als junger Tourist bei einer Führung durch die Katakomben gestohlen. Jetzt – am Ende meines Lebens – will ich mit mir ins Reine kommen.“
Man kann sich das bildlich vorstellen:
Ein Greis, umgeben von Erinnerungen, Briefmarkenalben und schlechtem Gewissen, sitzt an seinem Küchentisch und denkt:
„Bevor ich gehe, bringe ich wenigstens ihn zurück.“
Der Paketbote des Grauens
Und da möchte man wirklich wissen, wie das Gespräch mit dem DHL-Mitarbeiter lief.
„Was ist denn da drin?“
„Äh… ein alter Bekannter.“
„Lebensmittel?“
„Kommt drauf an, wie man’s sieht.“
Der Kopf reiste also brav von Norddeutschland nach Wien – vermutlich „versichert bis 500 Euro“.
Und angekommen ist er, ohne Zollkontrolle, ohne Panik – was übrigens beweist, dass manche Pakete wirklich durchkommen.
60 Jahre auf der Flucht
Man stelle sich das mal vor:
Der Schädel lag sechs Jahrzehnte lang irgendwo im Norden, vermutlich zwischen Hummelnest und Porzellankatze, und hat Dinge erlebt, die kein Gebein erleben sollte.
Vielleicht war er Deko im Wohnzimmer.
Vielleicht lag er im Keller, mit einer Schachtel Rübenkraut.
Oder wurde als „Gesprächsanreger beim Kaffeekränzchen“ missverstanden.
Und jetzt, Jahrzehnte später, kommt der Moment der Reue.
Nicht für Steuerhinterziehung, nicht für Umweltverschmutzung – sondern für Grabschändung.
Da zeigt sich wieder:
In Deutschland funktioniert das schlechte Gewissen verlässlicher als jede Rentenversicherung.
Die Rückkehr der Gebeine
Der Stephansdom war – man kann es kaum anders sagen – gerührt.
Der Domarchitekt, ein Mann mit wahrscheinlich jahrzehntelangem Skeletterfahrungshintergrund, sagte:
„Ich war bewegt.“
Und das glaubt man ihm.
Denn wann bekommt man schon mal einen Schädel per Post, der 60 Jahre auf Wanderschaft war und trotzdem zurückfindet – ohne Google Maps!
Leider, so Zehetner weiter, könne man den Schädel nicht mehr „den übrigen Gebeinen zuordnen“.
Na ja, kein Wunder. Nach sechs Jahrzehnten außerhalb der heiligen Hallen ist jede Zuordnung schwierig.
Aber der Kopf bekam eine würdige letzte Ruhestätte.
Endlich Ruhe.
Nach einem halben Jahrhundert Weltreise und wahrscheinlich unzähligen Staubwischaktionen.
Die Moral von der Geschicht
Ich, Ronald Tramp, sage:
Das ist keine einfache Geschichte – das ist ein Meisterwerk menschlicher Schuldverarbeitung.
Während andere Leute ihre Bibliotheksbücher zu spät zurückbringen, schickt dieser Mann Knochen.
Und das zeigt:
Die Deutschen nehmen alles ernst – selbst ihre Sünden.
60 Jahre lang trug er den Schädel mit sich herum, wahrscheinlich als Erinnerung, Mahnung und Gesprächsstück in einem.
Und als der Tod an die Tür klopfte, klopfte er zurück – an den Stephansdom.
Wenn Reue einen Preis hätte, bekäme dieser Mann den „Oscar der späten Einsicht“.
Er hat bewiesen, dass selbst ein Diebstahl aus der Unterwelt noch ein Happy End haben kann.
Vielleicht sollten wir das als Symbol sehen:
Die Menschheit kann Fehler machen – große, kleine, knöcherne –, aber solange jemand irgendwann die Courage hat, sie zurückzuschicken, ist noch Hoffnung.
Und wer weiß – vielleicht sitzt irgendwo ein anderer Senior in Bayern gerade vor einem alten Sarkophagdeckel und denkt:
„Mist… ich sollte das Ding auch mal wieder abgeben.“