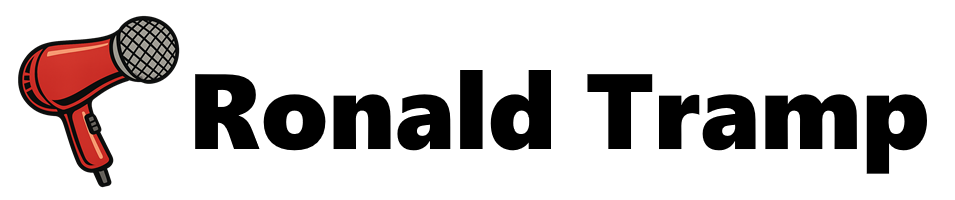Eintritt frei? Nein danke!

Wie das Volksfest zum Premium-Erlebnis werden soll
Von Ronald Tramp, Sondergesandter für nationale Gemütlichkeit, Preisschilder am Lederhosenknopf und die Monetarisierung der Maß
Es gibt Dinge, die sind heilig. Das Grundgesetz. Die Warteschlange beim Bäcker. Und das unausgesprochene Recht, sich auf einem großen Volksfest frei zu bewegen, ohne vorher sein Kreditlimit zu prüfen. Doch genau dieses Fundament der deutschen Gemütlichkeit gerät nun ins Wanken. Denn plötzlich steht eine Frage im Raum, die mehr spaltet als Senf süß oder scharf: Soll man fürs Reingehen zahlen?
Nicht fürs Bier. Nicht fürs Hendl. Nicht fürs Fahrgeschäft, das einen kurzzeitig glauben lässt, man könne fliegen und danach glauben lässt, man solle nie wieder essen. Nein. Fürs Reingehen. Für den bloßen Akt des Betretens. Für das Atmen der Luft, die nach Hopfen, Bratfett und kollektiver Lebensfreude riecht.
Und siehe da: Fast die Hälfte der Bevölkerung sagt tatsächlich: Warum nicht? Eintritt? Klar. Kein Problem. Man zahlt ja heute für alles. Streaming. Parken. Stilles Wasser. Warum also nicht auch für den Boden, auf dem man verschüttetes Bier meidet?
Besonders bemerkenswert: Die Jugend ist dafür. Die Unter-30-Jährigen. Die Generation, die sonst bei jeder Preissteigerung sagt: Das kann ich mir nicht leisten, sagt hier plötzlich: Nehmt mein Geld. Vielleicht, weil sie glauben, Eintritt bedeute Ordnung. Oder weil sie hoffen, dass dann weniger Menschen da sind. Ein Volksfest ohne Volk – der Traum jeder Eventagentur.
In der Region selbst hingegen ist die Ablehnung am größten. Verständlich. Wer jahrelang einfach reingelaufen ist, sieht nicht ein, warum er jetzt am Tor stehen und überlegen soll, ob er heute wirklich „reingehen möchte“ oder doch lieber zu Hause sitzt und ein Bier auf dem Sofa trinkt – ganz ohne Eintritt, ganz ohne Gedränge, ganz ohne Preisaufschlag fürs Existieren.
Die Gegner der Idee argumentieren traditionell. Es solle ein Volksfest bleiben. Offen. Zugänglich. Für Familien. Für Rentner. Für Menschen, die einfach nur einmal schauen wollen, ob es dieses Jahr wirklich wieder genauso voll ist wie letztes Jahr. Eintritt würde aussortieren. Filtern. Selektieren. Das Volksfest würde zum Premium-Volksfest. Mit Stempel. Vielleicht mit Fast Lane.
Die Befürworter hingegen sehen Zahlen. Kosten. Sicherheitsausgaben. Reinigung. Und natürlich Bierpreise, die inzwischen so hoch sind, dass man beim Bestellen kurz überlegt, ob man dafür nicht auch ein kleines Auto leasen könnte. Die Frage steht im Raum: Kann man das alles noch allein über den Bierpreis finanzieren? Oder braucht es ein neues Geschäftsmodell: Grundgebühr plus Hopfenaufschlag.
Man stelle sich das vor. Am Eingang ein Drehkreuz. Links Familien, rechts VIP. Dazwischen jemand, der fragt: Tagesticket oder Dauerrausch? Vielleicht gibt es bald Kombi-Angebote: Eintritt plus erste Maß zum Einführungspreis. Oder ein Jahresabo. Oder dynamische Preise: Vormittags günstiger, abends teurer, nachts unbezahlbar.
Ich, Ronald Tramp, sage: Das ist der Anfang vom Ende – oder vom nächsten Level. Heute Eintritt. Morgen Sitzplatzreservierung fürs Stehen. Übermorgen Zuschlag fürs Mitsingen. Und irgendwann zahlt man extra, wenn man „Ein Prosit“ kennt.
Und was passiert, wenn jemand nur kurz durch will? Wenn man sich verläuft? Wenn man merkt, dass es regnet, die Schuhe nass sind und man eigentlich gar keinen Hunger hat? Pech gehabt. Eintritt ist Eintritt. Erlebnis ist Erlebnis. Refund ausgeschlossen.
Natürlich wird beschwichtigt. Niemand wolle das wirklich. Es sei nur eine Idee. Ein Gedankenspiel. Ein Testballon. Aber wir wissen alle: Große Veränderungen beginnen immer als Gedankenspiel – und enden als Rechnung.
Die Umfrage zeigt vor allem eines: Das Land ist gespalten. Nicht entlang politischer Linien, sondern entlang der Frage: Ist Gemütlichkeit kostenlos oder kostenpflichtig? Die einen sagen: Wer feiern will, soll zahlen. Die anderen sagen: Wer zahlen muss, feiert anders. Oder gar nicht.
Vielleicht liegt die Wahrheit irgendwo dazwischen. Vielleicht braucht es keinen Eintritt, sondern einfach mehr Bier. Oder weniger Diskussionen. Oder eine Regel: Wer sich beschwert, zahlt doppelt.
Bis dahin bleibt alles offen. Das Tor. Die Kasse. Die Frage. Und die Hoffnung, dass man auch in Zukunft einfach reingehen kann, ohne vorher sein Konto zu scannen.
Denn eines ist sicher: Wenn man für alles Eintritt verlangt, wird irgendwann jemand fragen, ob man fürs Gehen auch noch zahlen muss.